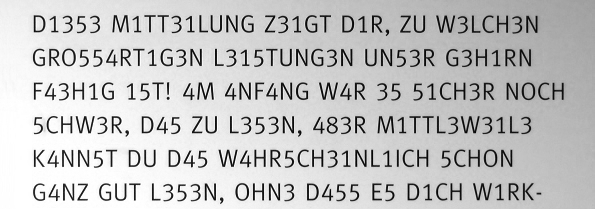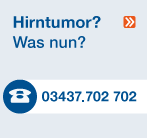MRT
Magnet-Resonanz-Tomographie
Die Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT), auch Kernspin-Tomographie genannt, ist ein diagnostisches Schnittbildverfahren zur Darstellung von Organen und Geweben mit Hilfe von Magnetfeldern.
Im Tomographen wird ein starkes Magnetfeld angelegt, wobei sich die Atomkerne (meist Wasserstoffkerne/Protonen) des menschlichen Körpers anhand des magnetischen Feldes ausrichten. Es folgt eine gezielte Änderung dieser Anordnung durch einen Frequenzimpuls, welcher die Atomkerne aus den Magnetfeldlinien lenkt und ihre Taumelbewegung synchronisiert.
Schaltet man diesen Frequenzimpuls wieder ab, gelangen die Kerne in ihren Ausgangszustand zurück (Relaxation). Dabei wird Energie in Form von Radiowellen frei, welche durch eine Detektorspule aufgefangen und gemessen werden können. Ein Computer berechnet aus den Signalen ein Schnittbild durch den Körper, wobei die Daten nach den Kriterien der Längsrelaxationszeit (T1) und der Querrelaxationszeit (T2) analysiert werden.
Je nach T1- beziehungsweise T2-Gewichtung werden die verschiedenen Gewebe in ihrer charakteristischen Signalstärke (Grauwerte) dargestellt. Hierbei spricht man von hyperintens (signalreich, hell) und hypointens (signalarm, dunkel).
In der T1-Gewichtung erscheinen zum Beispiel fetthaltige Gewebe und Strukturen (u.a. Knochenmark) heller als das umliegende Gewebe. Folglich eignet sich diese Form der Auswertung bei der anatomischen Darstellung von Organstrukturen, insbesondere nach Kontrastmittelgabe.
Bei der T2-Gewichtung werden wiederum Flüssigkeiten, wie Liquorräume hell dargestellt, was häufig bei der Visualisierung von Ödemen und der Abgrenzung von Zysten gegenüber soliden Tumoren Anwendung findet.
Die unterschiedlichen Relaxationszeiten verschiedener Gewebearten sowie ihr Gehalt an Wasserstoffkernen stellen eine wesentliche Grundlage für den Bildkontrast dar. Dementsprechend gibt es keine Normwerte für das Signal bestimmter Gewebe vergleichbar mit dem Hounsfield-Index bei der Computer-Tomographie. Die Bildinterpretation stützt sich hingegen auf den Gesamtkontrast und die Signalunterschiede zwischen verschiedenen Geweben.
Obwohl die Vergleichbarkeit verschiedener Gewebearten in der Magnet-Resonanz-Tomographie sehr gut ist, werden auch hier Kontrastmittel mit Erfolg eingesetzt. Diese in der MRT verwendeten Kontrastmittel sind im Allgemeinen gut verträglich. Die gängigsten Präparate stellen hier Gadoliniumverbindungen dar. Diese sind die am längsten erprobten Kontrastmittel der MRT, welche direkt in das Gefäßsystem injiziert werden und eine vermehrte Durchblutung sowie Gefäßneubildungen (wie etwa bei Tumoren) nachweisbar machen.
Die bessere Darstellbarkeit vieler Organe sowie die hohe Detailerkennbarkeit verschiedener Gewebe machen die MRT zu einer bevorzugten Methode in der Schnittbildgebung. Dabei kommt das Verfahren ohne potenziell schädliche Strahlung aus. Ein weiterer Vorteil ist die gute Visualisierung von Nerven- und Hirngewebe.
Metallimplantate (mit Ausnahme von diamagnetischen Titanverbindungen) und Herzschrittmacher können mit dem angelegten Magnetfeld in Wechselwirkung treten, was Komplikationen hervorrufen oder Bildstörungen verursachen kann.
Weitere Informationen für Hirntumorpatienten und Angehörige
Zurück zur Diagnose von Hirntumoren